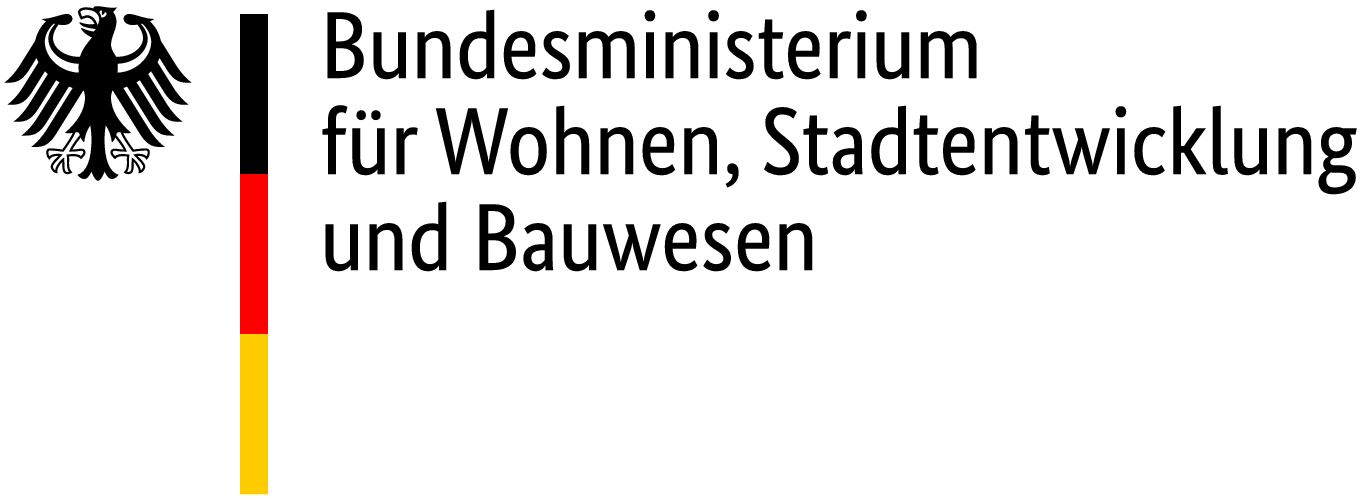FRANKLIN, Mannheim, Baden-Württemberg
Beschreibung
Wie lässt es sich in einer wachsenden Stadt auch in Zukunft gut leben? Wie verankert man den unverzichtbaren Raum zur Entfaltung in einem neuen Stadtteil für bis zu 10.000 Menschen? 144 Hektar beträgt die Konversionsfläche FRANKLIN, in deren Gestaltung die vielfältigen Wünsche und Ideen aus einem umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozess mit einfließen. Von Beginn an sind weitläufige und multifunktionale Grünflächen in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung vorgesehen, die Angebote für Menschen jeden Alters bereithalten und für alle barrierefrei zugänglich sind. Im Rahmenplan von 2013 verankert ist das „grüne U“; eine Parkfläche mit kontrastreichen Landschaftsstrukturen, die alle Teilbereiche des neuen Stadtteils miteinander verknüpft. 50 Hektar und damit ein Drittel von FRANKLIN bleiben unbebaut und den Bewohnern als grüner Freiraum erhalten. Der Rahmenplan ist in den fortgeschriebenen Planungen nahezu 1:1 umgesetzt: Mit den FRANKLIN GREEN FIELDS erhält der Stadtteil hochwertige Begegnungs- und Erholungsräume, welche die Geschichte der Fläche durch zahlreiche Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote im öffentlichen Raum fortschreiben. Die frei zugängliche FRANKLIN Sportanlage gehört zu den besten Mannheims, der zwei Meilen lange Rundweg Loop bietet Fußgängern und Sportlern eine ideale Strecke abseits des Straßenraums. Für Kinder und Jugendliche sind sieben abwechslungsreiche, fußläufig erreichbare Spielplätze entstanden, die Bewegungsfreude fördern und durch weitere Angebote wie Tischtennis, Skateanlage und Beachvolleyballfelder ergänzt werden. Abgerundet wird der wertvolle Freiraum durch gemeinschaftsfördernde Nutzgärten, in denen das Bewusstsein für gesunde Ernährung mitwachsen kann, und unzählige Treffpunkte im öffentlichen Raum zur Förderung der nachbarschaftlichen Gemeinschaft. So leisten die FRANKLIN GREEN FIELDS auch für das Leitbild 2030 einen Beitrag, in dem die Stadt Mannheim ihren Weg zu einer nachhaltigen, auch künftig lebenswerten Stadt festgeschrieben hat.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Deutschland, Nastätten, Rheinland-Pfalz
Beschreibung
Im Mai 2022 beschloss der Kulturausschuss der Stadt Nastätten die Initiative, einen Bienen- und Insektenpfad als Naturlehrpfad anzulegen. Schnell gründete sich eine ehrenamtliche Projektgruppe mit Bürgern auch außerhalb der städtischen Gremien und begann damit einen Spazier- und Kulturpfad am Hollenberg zu konzipieren. In aufeinander abgestimmten Maßnahmen sollen weitere Spazier- und Kulturlehrpfade unter dem Namen Blaumachen am „…“ entstehen. Der erste Pfad "Blaumachen am Holler" befindet sich in der Umsetzung. Auf einem ca. 3,5 km langen Rundweg sollen die Bürger motiviert werden, sich ein paar Stunden in der Natur zu bewegen und dabei mit Hinweistafeln die Vielfalt an Vögeln, Insekten, Hecken und Sträuchern kennenlernen. Dabei wurden die bereits vorhandenen Attraktionen wie Schutzhütte, Panoramaschaukel und Ruhebank integriert. Als weitere Attraktion wird es einen Panoramatisch "Blick ins Land" mit kleinen Fernrohren geben. Eine alte Tradition der ortsansässigen Blaufärber wird aufleben gelassen und ein Streifen mit Färberwaid angelegt. Hinweistafeln zur Geschichte der höchsten Anhebung der Blaufärberstadt Nastätten "Holler" werden erstellt und ein Klangspiel lädt zum Verweilen ein. Weitere Rundwege sind in Planung, so soll im Jahr 2024 ein in den 1980er Jahren angelegter ca. 4km botanischer Rundwanderweg "Weg der Bäume" wieder hergerichtet werden. Klimawandel und Borkenkäfer haben in den vergangenen Jahren dem „Weg der Bäume“ stark zugesetzt. Ideen gibt es noch viele, sodass auch weitere ehrenamtlicher Helfer gerne willkommen sind.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Conradtystraße 2 und 3, Bayern
Beschreibung
Bei dem Projekt „Leben im Spinnereipark Kolbermoor“ handelt es sich um eine einzigartige übergeordnete städtebauliche Entwicklung auf dem Areal der alten Spinnerei in Kolbermoor, die von ca. 1860 bis Anfang 1990 in Betrieb war. Aus einer eingezäunten, verfallenden Industriebrache wurde das pulsierende Herzstück, das neue Wahrzeichen von Kolbermoor, das den zukunftsweisenden städtebaulichen Anforderungen entspricht. Hervorzuheben ist die Nutzungsmischung – Wohnen, Arbeiten, Kunst, Kultur, Restaurants, Handwerk, Einzelhandel, soziale Einrichtungen, Freizeit, Erholung und Natur – die sich hier auf engem Raum verbinden. Es entstand und entsteht noch immer ein vorbildlicher Stadtteil der kurzen und barrierefreien Wege für alle Altersgruppen. Die hohe Wohnqualität, der direkte Anschluss zum Regionalbahnhof, zum übergeordneten Radwegenetz entlang des Mangfallkanals sowie die unmittelbare fuß- und radläufige Erreichbarkeit von Einrichtungen des täglichen Bedarfs tragen dazu bei, gerne auf das Auto zu verzichten. Tägliche Bewegung wird selbstverständlich. Das grüne Herz des Ensembles bildet der historische Spinnereipark: ehemals den Führungskräften der Spinnerei vorbehalten steht er nun offen für alle. Der Park vereint sowohl naturschutzfachliche Aspekte als auch den Wunsch nach einer aktiven Nutzung. So entstanden einerseits großflächige Retentionsbereiche mit Magerrasenstandorten, geschützte, artenreiche Renaturierungszonen des bestehenden Filzbachs, naturnahe Uferzonen am Weiher. Andererseits bietet der Park eine weitläufige Spielplatzanlage für jedes Alter, eingebettet in schattigen Baumbestand, Ruhezonen, Aussichtsplätze. Das historische Arboretum des Parks wurde mit neuen Pflanzungen umfangreich ergänzt. Seit 2018 wird Zug um Zug die Implementierung der Wohngebäude in den Park umgesetzt. Sensible, auf den genius loci abgestimmte Baukörper und deren Freiflächen fügen sich harmonisch in den Park ein und bilden eine Einheit.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Stadtteil Hahle, Hansestadt Stade, Niedersachsen
Beschreibung
Der Stadtteil Hahle ist gekennzeichnet durch eine heterogene Bebauung vorwiegend aus den 1960-1980 Jahren. Die bestehenden Grünflächen haben nur eine geringe Aufenthalts- und gestalterische Qualität. Der Stadtteilpark Hahle stellt mit dem verbindenden Wegekreuz durch den Park das grüne und verbindende Zentrum für den Stadtteil dar. So sind die Schule mit Kita und Hort ebenso angeschlossen wie die Kirche, der Discounter sowie die ansässigen kleinteiligen Gewerbe und Dienstleister. Der ursprüngliche Zustand des Parks bot wenig Attraktivität und Aufenthaltsqualität. Auch waren die Eingänge zu dem Park versteckt und unattraktiv. Um den Park wieder als sozialen Mittelpunkt des Stadtteiles aufzuwerten, wurde der Stadtteilpark als erstes Projekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Hahle durch Städtebauförderung umgesetzt. Ziele der Neugestaltung waren eine attraktive und moderne Gestaltung, Barrierefreiheit und mehr Sicherheit (Abbau von Angsträumen). Gleichzeitig wurde Bewegung und Sport in den Mittelpunkt gestellt. Auf der zentralen Achse liegen ein Kleinspielfeld sowie eine Anlage für Basketball. Eine Boulderwand wird noch mit einer barrierefreien Callestanicsanlage ergänzt. Die Gestaltung und Möblierung ist so konzeptioniert, dass für mobilitätseingeschränkte ausreichend Pausen möglich sind. Des Weiteren liegen die Sitzmöglichkeiten so, dass man immer auch im Geschehen ist. Besonderes Highlight ist ein Wassererlebnisbereich, der ebenfalls von Rollstuhlfahrenden genutzt werden kann. Der zentrale Zuweg entlang der Schule besitzt mit Balanciergeräten sowie andersfarbigen Trittsteinen ein eigenes Bewegungsangebot (Spiel: Berühre nicht den Boden), welches in den Park und zur Schule führt. Zudem wurde auf eine klimafreundliche bzw. klimaresiliente Gestaltung geachtet indem z.B. Versickerungsmulden, sowie eine öffentliche Trinkwasseranlage integriert wurden und durch klimaressiliente Bepflanzung Schattenbereiche geschaffen wurden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Altstadt, Stadt Osterode am Harz, Niedersachsen
Beschreibung
Die Idee des OneWorldGardens – als einem urbanen interkulturellen Gemeinschaftsgarten – entstand vor dem Hintergrund der besonderen baulichen Strukturen der Altstadt sowie aus der hohen Diversität der Bewohner*innen im Quartier. Zugleich inkludiert das Konzept die Metathemen unserer Zeit – Klimawandel, Pandemien, Kriege – und deren mannigfaltige Folgen. Es begegnet diesen Herausforderungen mit entsprechender Krisenresilienz, wie dem Erlernen von Selbstversorgung, lokaler Nahrungsmittelproduktion und insbesondere gemeinschaftlicher Zusammenarbeit. Im Zuge dieses neuen Projektes der sozial-ökologischen Stadtentwicklung wurde (als ergebnisoffener Prozess) versucht, alle Quartiersbewohner*innen gleichermaßen für die Mitgestaltung an ihrer Nachbarschaft zu gewinnen. Dabei ist es essentielles Ziel, einen unmittelbaren Nutzen sowie greifbaren und langfristigen Gewinn für das eigene Leben im Quartier zu vermitteln. Es soll ohne Zwang ein Bewusstseinswandel implementiert und ein inhärenter Handlungswille aktiviert werden, der die Bewohner*Innen dazu befähigt die öffentlichen Räume thematisch zu erobern. Insbesondere die Arbeit an dem gemeinschaftlich organisierten Projekt des OneWorldGardens im Stadtraum bildet den Ansatz, eine freiwillige Vernetzung und Kooperation auszuprobieren und entsprechend kollektiv zu handeln. In einem weiteren Entwicklungsstadium soll daraus eine sich selbst tragende und offene Organisationsform entstehen, die die quartiersbezogenen Zukunftsprozesse mitgestalten kann. Die konkrete Projektumsetzung begann im August 2023 durch ein internationales Jugendcamp, Quartiersbewohner*innen und Unterstützung durch die Stadt. In rund zwei Wochen wurden auf der Brachfläche zahlreiche Hochbeete gebaut, mit Humus befüllt und teilweise bepflanzt. Nach sehr positiver öffentlicher Resonanz begann noch vor der Jahreswende die Schaffung konkreter Workshops und die Community-zentrierte Organisation für die weitere Fortentwicklung des öffentlichen Gartens im Jahr 2024.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Ostpark, Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz
Beschreibung
Der Ostpark in Landau in der Pfalz führte als Überbleibsel der Vauban-Festung trotz Innenstadtnähe lange Jahre ein Schattendasein: neben regelmäßigem Fischsterben aufgrund des eutrophierten Schwanenweihers, waren Drogen- und Alkoholprobleme neben fehlendem Angebot für junge NutzerInnengruppen, unzureichende Beleuchtung und Wegeführungen sowie fehlende Aufenthaltsmöglichkeiten und schlecht erhaltene historische Relikte wesentliche Problemstellungen zu Beginn der Sanierungsmaßnahme im Rahmen des Bundesförderprogramms "Soziale Integration im Quartier". Begleitet von zahlreichen Beteiligungsformaten wie geführten Spaziergängen, Workshops bis hin zum moderierten Eigenbau der Spielgeräte stehen den NutzerInnen nach der Sanierung Informationsrundweg, zwei Laufstrecken, ein Wasser- und Kinderspielplatz, Fitness-Wasserräder, 50 Laufmeter neue Sitzmöglichkeiten, Liegedecks am Wasser und eine neue Calisthenics-Anlage zur Verfügung. Die wieder begehbare Aussichtskanzel, ein Vauban-Relikt der historischen Festung, eine sanierte Festungsmauer sowie zahlreiche historische Spuren ergänzen den zentralen Stadtpark. Die umfangreiche Gewässersanierung (Problemerfassung über Sohlbegehungen, Wasseruntersuchungen, Zulauf- und Abflussproben, Abfischen, Sömmerung, Eintiefung, Abdichtung mit natürlichen Baustoffen, Anlegen von Wasserfilterzonen in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz, Sanierung der historischen Ufereinfassungen, verbunden mit einer laufenden Aufklärung bezüglich Wasservögelfütterung) brachte das historische Spiegelbild der angrenzende Festhalle zurück in die Wahrnehmung der Landauer Bevölkerung und ein neues Gleichgewicht für den Schwanenweiher als Flutkessel der prägenden Festungsanlagen. Mit behutsamen Eingriffen unter Berücksichtigung der gewachsenen und historischen Zeitschichten wurden neue Angebote für zeitgemäße Nutzungen geschaffen, so dass der Park künftig seinen vielfältigen sozialen, ökologischen wie klimatischen Anforderungen gerecht werden kann.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Klosteranger, Gemeinde Weyarn, Bayern
Beschreibung
Der Klosteranger in Weyarn ist ein lebendiger Ort für Gemeinschaft. Das war nicht immer so: Als in der kleinen oberbayerischen Gemeinde das Kloster aus dem 12. Jahrhundert saniert und auf den Grundmauern der abgebrannten Prälatur zwei neue Gebäude errichtet wurden, bot es sich an, auch die unmittelbar an den Ortskern angrenzende Klosterwiese – eine 5 Hektar große landwirtschaftliche Brachfläche – zu entwickeln. Man nutzte die Chance, die Ortsentwicklung im Innenbereich gezielt zu steuern und eine Flächenversiegelung außerhalb des Ortskerns zu vermeiden. Mit dem „Weyarner Modell“ verfügt die Gemeinde über eine etablierte und gelebte Bürgerbeteiligung. So wurde auch der Klosteranger zu einem Projekt für alle und macht die Gemeinde heute zu einem Vorzeigeprojekt für strategische Dorfentwicklung und Mehrgenerationenwohnen. Der Klosteranger zieht sich zwischen dem historischen Ortskern und dem neuen Wohnviertel als autofreier Grünraum durch die Bebauung und besteht aus 7 Mehrgenerationenhäusern sowie 45 Reihen- und Doppelhäusern . Bewusst wurde die Bebauung des Areals zugunsten von Freiräumen für Alle reduziert. Damit widerstand die Gemeinde der Versuchung der Gewinnmaximierung. So wurden kleinere und damit günstigere Bauparzellen ermöglicht und zugleich ein großer öffentlicher Grünbereich mit Aufenthaltsqualität gewonnen. Die Idee einer lebendigen und integrativen Gemeinschaft zeigt sich in Weyarn in einem zukunftsweisenden Konzept: Statt die Gärten der Eigenheime konsequent abzuschirmen, entschied man sich für kleinere private Rückzugsorte und einen weitläufigen, kollektiv nutzbaren Grünraum. Geschwungene Wege führen vorbei an Rosengarten, Streuobstwiese, Kinderspielplätzen, Bänken oder einer Boule-Bahn und schaffen Orte für ein gutes Zusammenleben. Mittendrin: Der Generationengarten für gemeinschaftliches Gärtnern. Der Gemeinschaftsgarten steht allen offen – jeder darf mitarbeiten oder auch nur ernten, denn der Garten gehört Allen und alles was darin wächst auch.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Dyckerhoff-Weg, Oppenheim, Rheinland-Pfalz
Beschreibung
2019 hat die Stadt Oppenheim unter dem Titel „Schenk mir einen Baum“ einen Spendenaufruf zu Baumpflanzungen gestartet. Ziel war es, im Zuge des Klimawandels mit der Pflanzung von großkronigen klimafesten Laubbäumen u.a. den so genannten Dyckerhoff-Weg in der von Weinbau geprägten und daher baumarmen Landschaft einen ökologischen Beitrag zu mehr Biodiversität zu leisten. Mit diesen Spenden und Mitteln der Stadt ist es gelungen, einen vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Weg zu einer Allee aufzuwerten und zu Wanderungen zu animieren, denn der Weg führt von der Altstadt über die Burgruine Landskrone hinaus in die Weinberge. Die Spender können „ihren Baum“ über eine Nummernplakette identifizieren. Die Aktion wurde gemeinsam mit der Nachbarstadt Nierstein realisiert, denn der Weg verlauft an der Gemarkungsgrenze. Kuriosum: Der Weg selbst liegt auf Niersteiner Gemarkung, die Fahrbahn gehört jedoch der Stadt Oppenheim. Auch Niersteiner Bürger haben für die Aktion gespendet. Ein Niersteiner Weingut und auch die Bauhöfe der beiden Städte haben sich mit Pflegemaßnahmen (Wässern der Bäume bei Trockenheit) an der Aktion beteiligt. Die Aktion hat zudem weitere Impulse gegeben. Auf Initiative von Winzern ist darauffolgend auf einer Seitenfläche des Weges (Fläche der Stadt Oppenheim, aber Niersteiner Gemarkung) ein möblierter Rastplatz entstanden. Weitere Bäume, zwei Sitzgarnituren mit Tisch und Bänken sowie ein Liegesofa zählen jetzt zur Ausstattung und laden zum Verweilen ein. Weil der Ort einen weiten Blick in das Oberrhein-Tal bis in den Taunus, nach Frankfurt und in den Odenwald ermöglicht, wurde zudem auf der gegenüberliegenden Seite ein Landschaftsrahmen gestiftet, der zum Fotografieren animiert. Weg und auch Rastplatz werden ganzjährig rege für Ausflüge und Spaziergänge genutzt – von Einheimischen und Touristen. Außerdem ist der Rastplatz sowohl für Oppenheimer als auch Niersteiner Weinbaubetriebe ein beliebter Haltepunkt im Rahmen von Weinbergsrundfahrten.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Ruit, Stadt Ostfildern, Baden-Württemberg
Beschreibung
Die „Grüne Mitte“, ein mehr als 7.000 m² großer Grünzug, liegt an zentraler Stelle in Ruit. Sie verbindet den Bereich des Rathauses und Bürgerhaus sowie Grundschule und Sporthalle mit dem Ruiter Ortskern. Neben der Naherholung und der klimatischen Bedeutung hat die Grüne Mitte auch eine wichtige Erschließungsfunktion und ist Schulweg für die unmittelbar an das Rathausareal angrenzende Grundschule. Angrenzend dran befinden sich zudem verschiedene Einrichtungen der Altenpflege und -betreuung, das denkmalgeschützte Pfarrhaus sowie die evangelische Kirche. Die Grüne Mitte war über Jahrzehnte eine Obstbaumwiese ohne konkrete Nutzungen. In Teilbereichen war über die Jahre ein Wildwuchs an Büschen und Sträuchern entstanden, der das angrenzende denkmalgeschützte Pfarrhaus, für viele eines der schönsten Gebäude in Ruit, verdeckte. Beim Tag der Städtebauförderung 2015 wurden die Ruiter gefragt, was sie sich künftig von der Grünen Mitte wünschen. Dabei stellten sich mehrere Schwerpunkte heraus. Die Anlage eines Spielplatzes war einer der meist genannten Punkte. Der kleine Bachlauf, der bis dahin weitestgehend zugewachsen und trocken gefallen die Grüne Mitte durchquerte, sollte wieder erlebbar werden. Und schließlich war es der Bevölkerung auch wichtig, den Grundcharakter des Grünzugs als eine Obstbaumwiese zu erhalten. Die Umgestaltung hat diese Ideen aufgegriffen. Der Zugang zur Kirche wurde komplett erneuert und bildet jetzt den Auftakt zur Grünen Mitte. Das Pfarrhaus ist heute weithin sichtbar. Davor liegt eine Anlage mit Sitzstufen, die auf einen kleinen Platz führt, der für unterschiedlichste Veranstaltungen und sportliche Aktivitäten nutzbar ist. Ein großer Spielplatz wurde gebaut und das Wegenetz ergänzt. Der Bachlauf führt wieder Wasser und es gibt Bewegungsangebote für Senioren. Den flächenmäßig größten Anteil bildet auch nach der Umgestaltung noch eine Obstbaumwiese, die durch eine intensivere Pflege variable für unterschiedliche Aktivitäten nutzbar gemacht wurde.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Stadtteil Volmarstein, Stadt Wetter (Ruhr), Nordrhein-Westfalen
Beschreibung
Die Stadt Wetter (Ruhr) hat ein Spielplatzkonzept erarbeitet, um die Spiel- und Bewegungsflächen stadtübergreifend nachhaltig zu entwickeln und insbesondere Kindern, aber auch für andere Generationen, wohnortnahe Angebote zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde auch der in die Jahre gekommene Spielplatz an der Heilkenstraße neu gestaltet und als Zukunftsspielplatz ausgebaut. Die Kategorie "Zukunftsspielplatz" ist dabei die höchste Kategorie im Rahmen des Spielplatzkonzeptes mit stadtteil- bzw. stadtweiter Bedeutung und verfügt über eine entsprechende Ausstattung. Ziel des Konzeptes für den Zukunftsspielplatz Heilkenstraße war es, einen inklusiven Ort für alle Generationen zu schaffen, der als Spiel- und Bewegungsraum sowie als Begegnungsstätte dient. Entsprechend ist die Anlage nicht nur auf kleine und große Kinder ausgerichtet, sondern auch für Senioren und Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Um den Spielplatz bestmöglich auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer auslegen zu können wurde in April/ Mai 2021 eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Ergebnisse und Wünsche zu den Spiel- und Bewegungselementen auf dem Spielplatz wurden ausgewertet und sind in die weitere Planung und Umsetzung eingeflossen. Als weiterer Meilenstein ist die erfolgreiche Umsetzung des Projektes in 2023 zu sehen. Seither erfreut sich der Spielplatz großer Beliebtheit. Die Fläche an der Heilkenstraße liegt im bevölkerungsreichsten Stadtteil der Stadt Wetter (Ruhr). Obwohl im Grünen gelegen, liegt der Spielplatz unmittelbar zwischen den beiden größten Ortsteilen des Stadtteils Volmarstein, Grundschöttel und Volmarstein (Dorf), und bietet somit gute Standortvoraussetzungen für eine fußläufig erreichbare Aufenthaltsfläche für eine große Bevölkerungszahl. Durch die Ausstattung bietet es ein niederschwelliges Spiel-, Sport- und Bewegungsangebot für alle Generationen.
Steckbrief der Einreichung (PDF)