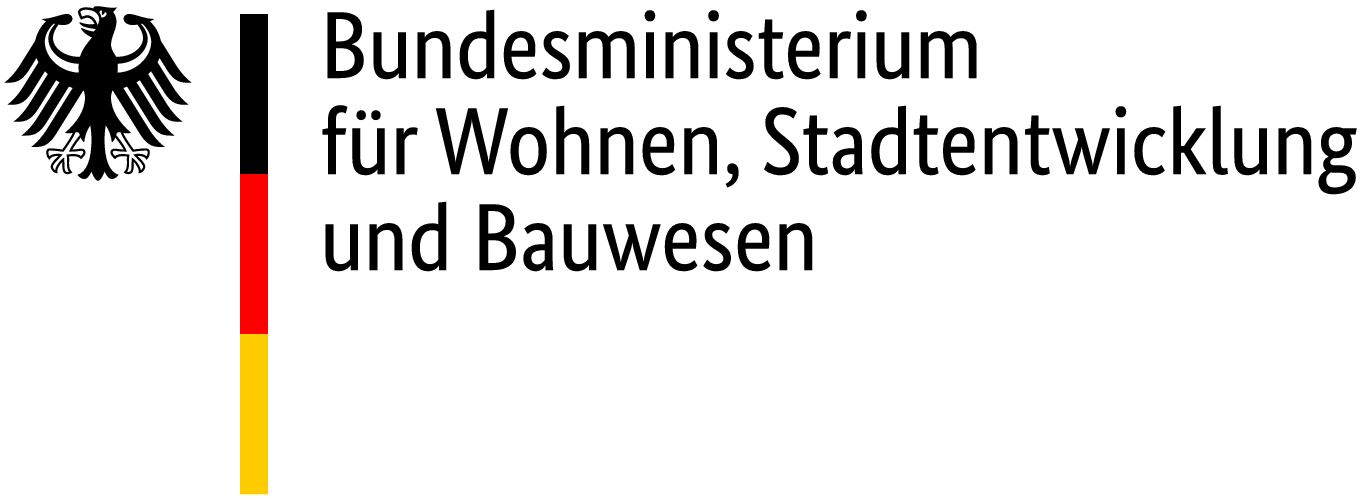Anerkennung in der Kategorie Bauliche Maßnahme
Westliche Höhe, Flensburg , Schleswig-Holstein
Fotos: Bundespreis Stadtgrün/Hergen Schimpf
Beschreibung
Einreichende Gemeinde: Flensburg
Einwohnerzahl: 99.000
Bundesland: Schleswig-Holstein
Das Projekt verbindet das Gartendenkmal Christiansenpark mit dem Alten Friedhof und dem Museumsberg zu den Flensburger Landschaftsgärten. Die Aktivierung dieser Flächen lässt ein zusammenhängendes, ästhetisch ansprechendes Parkgelände entstehen, das verschiedene Nutzergruppen zur Bewegung und Entspannung einlädt. Sämtliche neu gestalteten Elemente mussten dabei mit den Anforderungen des Denkmalschutzes und des Naturschutzes vereint werden. Verschiedene Spiel- und Bewegungselemente, eine von Schülerinnen und Schülern geschaffene Spielskulptur sowie ein Wasserspiel bereichern heute das geschichtsträchtige Gartenensemble um eine weitere Schicht. Zusätzlich wird der Ort in das stadtweite Programm „Flensburg bleibt in Bewegung“ aufgenommen.
Jurybewertung
Vorbildhaft vereint das Projekt Flensburger Landschaftsgärten denkmalpflegerische Ansprüche mit Ansprüchen an eine Landschaft, die Menschen zur Bewegung in der Natur animiert. Im Prozess fand eine umfassende Beteiligung der Bevölkerung statt, die ihre Ideen äußern konnte.
Dabei werden Elemente, wie farbenfroh gestaltete Spielelemente für Kinder mit eher zurückhaltenden, naturbelassenen Flächen kombiniert, die eine freie Aneignung ermöglichen. Es entsteht ein Raum von hoher Aufenthaltsqualität, der die Landschaftsgärten als zusammenhängenden Raum inszeniert, reaktiviert und für absehbar erhöhte Anforderungen ausrüstet. Dabei bleibt der Charakter der Anlagen als städtischer Garten erhalten, der gleichzeitig für eine zurückhaltende Integration von Bewegungsangeboten im Alltag sorgt. Von der Zusammenführung und Gestaltung der Flächen Museumsberg, Alter Friedhof und Christiansenpark in die Landschaftsgärten profitieren nicht zuletzt die einzelnen Bestandteile durch eine umfassende Aufwertung.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Nord-Neukölln, Berlin , Berlin
Beschreibung
Das Weigandufer und der Weichselplatz liegen in Nord-Neukölln entlang des Neuköllner Schifffahrtskanals. Das Weigandufer ist der einzige Zugang zu Erholungsräumen am Wasser in einem der dichtesten Wohngebiete Berlins und die Verbindung zwischen den Parkräumen Wildenbruchplatz und Weichselplatz. Das Weigandufer wirkte vor der Sanierung wenig einladend: Die gewöhnliche Verkehrsstraße war an der Uferseite von dichten Böschungen und eingeschränkt zugänglichen Pfaden und wenigen Nutzungen geprägt. Mit den Sanierungsmaßnahmen Weichselplatz und Weigandufer sollte das Ufer für die Anwohner*innen geöffnet und als Teil der überbezirklichen Wanderroute „Innerer Parkring“ für erholungssuchende Menschen aktiviert werden. Dafür wurde der Straßenraum als Fahrradstraße bzw. autofreie Straße geplant. Die Fahrbahnfläche wurde zurückgebaut und somit Platz für Passant*innen und Grünflächen gewonnen. Die Grünflächen wurden auf ganzer Distanz mit Versickerungsmulden ausgestaltet, um das Ufer auch bei Starkregenereignissen nutzbar zu machen und mit vielfältigen Sträuchern und Stauden bepflanzt. Zum Verweilen oder Bewegen am Ufer wurde an verschiedenen Stellen Stadt-Mobiliar und Fahrradabstellmöglichkeiten installiert. Die Stärkung der grünen Mobilität sowie die Qualifizierung von Erholungsflächen erfüllen die Bedürfnisse der Anwohnenden und Nutzenden in Neukölln, so dass die Flächen seit der Umsetzung stark nachgefragt werden. Die Trennung der Bereiche für den Fahrrad- und den Fußverkehr ermöglicht eine komfortable Nutzung für die jeweiligen Verkehrsarten. Das westliche Ende der Maßnahme bildet der Weichselplatz. Der Park bietet nach der Umsetzung der Sanierung mehrere kleinteilige Bereiche zur Erholung und zur Bewegung. Zur Erholung wurde der Uferweg neugestaltet und ausschließlich für den Fußverkehr freigegeben sowie eine Liegefläche angelegt. Kleine Biotopflächen wurden nördlich und südlich des Kanals instandgesetzt, die zum Erkunden und Beobachten der Natur einladen.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Kosmosviertel, Berlin, Berlin
Beschreibung
Das in der 1980ern in Plattenbauweise errichtete Wohngebiet im Stadtteil Altglienicke im Bezirk Treptow-Köpenick wird als Kosmosviertel bezeichnet. Prägend für das Gebiet ist der zentrale öffentliche Grünzug, der in der Nachwendezeit entstanden ist und nicht mehr den Ansprüchen eines zukunftsfähigen Stadtraums genügt. Die Grünflächen sind von zentraler Bedeutung für die Wohn- und Aufenthaltsqualität, besonders im Hinblick auf die oft zu engen Wohnverhältnissen und den Bewegungsmangel in vielen Haushalten. Es handelt sich um den größten zusammenhängenden, im Mittelpunkt des Quartiers befindlichen und identitätsprägenden Grün- und Freiraum . Hier sind alle Bildungsorte (Kitas, Schulen, Bibliothek, Jugendclub, Familienzentrum) und Nahversorgungseinrichtungen (Läden, Gaststätten) unmittelbar in fußläufiger Entfernung angebunden. Als halböffentliche Freiräume ergänzen frei zugängliche Innenhöfe mit integrierten Spiel- und Sportflächen diesen Grünzug. In diesen befinden sich kleinere Spielflächen für Kinder, Bolzplätze und der sog. "Kiezkreisel" mit Sportgeräten für Erwachsene. Der öffentliche Grünzug wird aktuell mittels Finanzierung durch “Zukunft Stadtgrün” aufgewertet und entsprechend der Nutzungsansprüche der Anwohnenden gestaltet. Die Qualifizierung beinhaltet eine barrierearme Umgestaltung und die Entwicklung von Freiräumen und Plätzen mit attraktiven Bewegungs-, Verweil- und Begegnungsorten für die Nachbarschaft. Diese umfasst Spiel- und Sportbereiche, verkehrssichere Querungen sowie eine Gestaltung, durch die Angsträume abgebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einer nachhaltigen Pflege und Instandhaltung der Grünflächen. Entlang von Wegen mit öffentlicher Bedeutung, wie beispielsweise der Schulweg zur einzigen Grundschule im Gebiet, wird die Beleuchtung in Hinblick auf Sicherheit neu konzipiert. Als Beitrag zur Klimaanpassung wird im Rahmen der Umgestaltung das Konzept der Schwammstadt mit Versickerungsmulden, Tiefbeeten und Rigolen umgesetzt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Riedgraben Ludwigsburg, Ludwigsburg, Baden-Württemberg
Beschreibung
Ludwigsburg, bekannt als barocke Stadt, geprägt durch Schloss und historische Allen hat sich mit Stadt- und Freiflächenentwicklungskonzept ein gesamtstädtisches, grünes Verbundsystem, das die Durchgängigkeit in den Außenbereichen fördert, die Kernstadt umschließt und die Stadtteile mit der Innenstadt verbindet, als Ziel gesetzt. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Grüne Ring. Eine Abfolge unterschiedlichster Grünflächen als Bewegungs- und Naherholungsgebiet für Menschen wie auch als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Mitten in Eglosheim reihen sich Biotope, Kleingärten, Streuobstwiesen und landwirtschaftlich genutzte Flächen aneinander und bilden den Grünzug Riedgraben. Viele Ehrenamtliche kümmern sich seit Jahrzehnten um dieses Gebiet, pflegen und erhalten es. Der Riedgraben als Abschnitt des Grünen Rings in Eglosheim verbindet das Ortszentrum mit dem Friedhof und dem Seeschloss Monrepos im Norden. Das austretende Quell- und Hangwasser, das bisher auf den Wegebereich floss, führte zu Pfützenbildung. Dichte Vegetation, Kleingärten mit Stacheldrahtzaun bis zur schmalen Wegefläche und fehlende Öffnungen sorgten insbesondere in den Abendstunden für Unwohlsein. Im Februar 2021 bewilligte die Region Stuttgart über 430.000 € Fördermittel für die Aufwertung des Riedgrabens. Damit bot sich die Gelegenheit, den Riedgraben nutzbarer und attraktiver zu machen. Fokus wurde auf die vorhandenen Potentiale des Ortes, die Bedürfnisse der Menschen sowie der dortigen Tier- und Pflanzenwelt gelegt. Es entstand ein Herzensprojekt: die naturnahe Umgestaltung des Riedgrabens für die Naherholung mit barrierefreier Erschließung, Einfassung der Quelle und attraktiven Bereichen zum Verweilen sowie für Sport und Spiel.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Drewitz, Potsdam, Brandenburg
Beschreibung
Angelehnt die Neugestaltung des Stadtteils zur Gartenstadt Drewitz, welche die klimafreundliche und sozialverträgliche Umgestaltung des Stadtteils zum Ziel hat, entstand die Idee, die Wendeschleife zu einem Gemeinschaftsgarten und einer multifunktionalen Fläche für das breite Spektrum der Anwohnerinnen und Anwohner nutzbar zu machen. Die multifunktionale Fläche verkörpert eine Vorbildfunktion und dient als grüner Bildungsraum im Sinne der Klimaanpassung. Auf der Fläche kommen Menschen verschiedener Alters- und Herkunftsgruppen zusammen. Sie nutzen die vielfältigen, niedrigschwelligen Angebote, um sich körperlich zu betätigen und am sozialen Leben teilzunehmen. Das Projekt versteht sich auch als Mittel gegen häusliche Einsamkeit und nicht zuletzt als integratives Werkzeug. Es trägt zur Sensibilisierung im Umgang mit Stadtgrün bei und dient als Naherholungsort. Durch die vielfältige Anregung der Sinne animiert es zur Bewegung im Freien. Die größten Erfolge sind die Auszeichnung mit dem UN-Dekade Sonderpreis „Soziale Natur – Natur für alle“ am 13.09.2020 und der Potsdamer Klimapreis 2021, der traditionell auf dem Potsdamer Umweltfest verliehen wird. Außerdem verzeichnet das Projekt eine seit Beginn stetig steigende Nutzerzahl. Sowohl das Interesse an den sportlichen Angeboten wie auch bei der Mitwirkung an den gärtnerischen Tätigkeiten oder auch zum Aufenthalt im Freien wächst. Der Ort ist mittels Tram, Bus, Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Die Wendeschleife ist barrierearm begehbar. Sie befindet sich inmitten des Wohngebiets in Drewitz und dient mit seiner Lage als Bindeglied zwischen den Stadtteilen Drewitz und Kirchsteigfeld. Sie ist von mehreren Kitas, Schulen und von den Wohngebäuden in direkter Nachbarschaft gut zu erreichen.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Langen, Stadt Geestland , Niedersachsen
Beschreibung
Niedersachsen unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten. Das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ umfasst 117 Millionen Euro aus der EU-Aufbauhilfe REACT EU im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und soll Kommunen dabei unterstützen, ihre Innenstädte zukunftssicher aufzustellen. Die Stadt Geestland bekommt aus dem Sofortprogramm insgesamt 793.500 Euro. Das Fördergeld wird zur Attraktivierung der Grundzentren in Langen und Bad Bederkesa verwendet. Konkret wird das Projekt "Rückhalt für Mensch und Natur" umgesetzt. Hierbei geht es um die Gestaltung und Aufwertung der Grünbereiche zur Naherholung in der Ortsmitte Langen. Die Ortsmitte von Langen ist umgeben von Grünflächen, die bisher allerdings nicht erschlossen waren. Der Marschensee befindet sich 300 Meter westlich vom Lindenhoff-Zentrum. Hierbei handelt es sich um ein Regenwasserrückhaltebecken. Dieser Bereich wurde bereits stark von Fußgängern, Kindern und Erholungssuchenden genutzt. Bemängelt wurde allerdings die schlechte Wege- und Aufenthaltsqualität. Hier sollte durch die Installation eines Sinnesparks eine deutliche Aufwertung erfolgen. Wichtig war jedoch, der Erhalt und eine Aufwertung des vorhandenen, naturnah angelegten Regenwasserrückhaltebeckens als wichtiger Rückzugsraum und Brutstätte für Vogelarten. Dieses künstlich angelegte technische Bauwerk dient in erster Linie dazu Regenwasser zu speichern. Richtig angelegt kann sich aber ein wertvolles Biotop entwickeln und gerade Amphibien und Reptilien gute Lebensbedingungen bieten. Das freizugängige und zentral gelegene Areal ist Teil der Initiative "EU in meiner Schule", hierbei bietet die Europäische Kommission Schülerinnen und Schülern der beteiligten Region die Möglichkeit, EU-finanzierte Projekte zu besuchen. Das Projekt wurde vor Ort altersgerecht erklärt und durch Aktionen als zukünftiges grünes Klassenzimmer "erlebbar und bewegbar" gemacht.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Metropole Ruhr, Metropole Ruhr (DU,OB, GE, HER, DO), Nordrhein-Westfalen
Beschreibung
Die 5 Revierparks stellen einen in Deutschland einzigartigen Parktypus aus den 1970er Jahren dar, den es in seiner Programmatik nur im Ruhrgebiet gibt. Bis heute sind sie sowohl bedeutende, frei zugängliche Orte der siedlungsnahen Erholung, Freizeit und Begegnung als auch zentraler Bestandteil des übergeordneten Freiraumverbunds der Metropole Ruhr. Durch die zentrale Lage im regionalen Grünzugsystem und die Einbindung in Radwegenetze haben die Parks Einzugsgebiete von ca. 2 Mio. Menschen. Nach 50 Jahren Bestand forderten veränderte klimatische und gesellschaftliche Anforderungen eine ökologische Aufwertung sowie eine integrativere Gestaltung und Modernisierung der Freizeitangebote der 30-45 ha großen Parkanlagen. Die Zielsetzung der Revitalisierung war die Schaffung kostenfreier, erlebnisreicher Begegnungs-, Bildungs-, Spiel- und Sportangebote für alle Menschen in artenreicher Natur. Jeder Park erhielt ein eigenes Motto, das sich in den Trend- und Funsportanlagen, Sport- und Spielplätzen und Umweltbildungs-, Erlebnis- und Gesundheitsangeboten wie Calisthenics, Boulderfelsen, Pumptrack, Fitnesszirkel oder Abenteuerspielplätzen sowie in unterschiedlichen Parkfarben widerspiegelt. Parkübergreifende, barrierearme Möblierung, Beschilderung und Beleuchtung sorgen für Zugehörigkeit und Wiederkennung. Zur Erhöhung der Artenvielfalt entstanden vielfältige, neue Lebensräume und die getätigten Entsiegelungen und Rückbauten kommen der Bodenfunktion und dem Klima zugute. Exemplarisch stellen wir anhand des Revierparks Nienhausen das räumliche Konzept und das Übersetzen auf den spezifischen Ort dar. Dazu gehörte der sensible Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz und der Formensprache der 1970er Jahre. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Gesundheits- und Bewegungsförderung in öffentlichen Parkanlagen sowie zur Erhöhung der Biodiversität und stärkt das regionale Freiraumsystem. Allein am Eröffnungstag besuchten über 25.000 Menschen die Revierparks.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Innenstadt, Stadt Bocholt, Nordrhein-Westfalen
Beschreibung
Inmitten der Bocholter Innenstadt, in der sogenannten Altstadt, wurde die Grünanlage an der Weberstraße umgestaltet. Veraltete Spielgeräte und in die Jahre gekommenes Sitzmobiliar entsprachen nicht mehr den heutigen Ansprüchen und prägten die mangelnde Aufenthaltsqualitäten auf der Grünfläche, sodass die Umgestaltung eine Maßnahme in dem Innenstadtentwicklungskonzept der Stadt Bocholt war. Begleitet wurde der Planungsprozess durch das Projekt „Zukunftsstadt Bocholt 2030+“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, das mit vielfältigen Beteiligungsaktionen für eine aktive Mitwirkung bei der Innenstadtentwicklung sorgte. Ziel war es, gemeinsam mit Anwohnern, Bürgern und künftigen Nutzergruppen ein gemeinsames Konzept für die Grünfläche zu entwickeln. Insbesondere die Bewohner des Seniorenheims sowie Kinder der nahegelegenen Kita sollten bei der Planung eingebunden werden. Durch die Neugestaltung und -anordnung der verschiedenen Aufenthalts- und Spielbereiche sollte die Grünfläche Jung und Alt zusammenbringen. Eine Einigung auf das Ziel, einen kleinen, generationsübergreifend nutzbaren Park für Begegnungen in der Innenstadt zu schaffen, war schnell hergestellt. Die Bocholter haben aktiv an dem Planungsprozess mitgewirkt und zum Beispiel bei der Auswahl der „bewegten“ Sitzelemente und der Spielgeräte mitentscheiden. Ein weiterer Punkt der Umgestaltung war, das niedrige Strauchwerk, das Wege und Spielgräte umgab, durch eine ökologisch hochwertige Staudenbepflanzung sowie ergänzende Baumpflanzungen zu ersetzen. 2022 konnte die Grünanlage feierlich eingeweiht werden. Durch die Schaffung des Treffpunktes sind regelmäßige Treffen der Seniorenheimbewohner und Kita-Kinder wieder aufgeblüht und die Grünfläche stellt eine wichtige Fläche zur Naherholung für die Innenstadtbewohner dar.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Stadt Sendenhorst, Nordrhein-Westfalen
Beschreibung
Der Innenstadtbereich der Stadt Sendenhorst wird durch eine umlaufende Grünanlage, die Promenade, begrenzt. Die Promenade liegt im Bereich der ehemaligen Stadtbefestigung der Stadt, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Sicherheit der Stadt in Form von aufeinander folgenden Wall- und Grabenanlagen gewährleistete. Teilweise existieren zwischen Promenade und Kernbereich noch schmale, nur fußläufig erschlossene Verbindungsgassen, die zusammen mit dem Ring der Promenade das historische Stadtbild im vielfältigen Gefüge ablesbar machen. Südwestlich der Innenstadt liegt das St. Josef-Stift, eine der größten Rheuma- und Rehabilitationskliniken Nordrhein-Westfalens. Im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes Sendenhorst, sollte im Umsetzungsschritt II „Alte Wege neu erleben“ auch die in ihrer Identität in großen Teilen verunklarte Promenade aufgewertet werden. Ziel ist die städtebaulich gestalterische Stärkung der gestalterischen Identität des Promenadenrings mit Blick auf die Zweiteilung in einen „naturhaft ländlichen Gartencharakter“ ausstrahlenden Nordteil und einen durch „traditionell gartenkünstlerischen Alleecharakter“ gekennzeichneten Südteil sowie das Herausarbeiten des Promenadenrings bzw. seiner intuitiven Ablesbarkeit als durchgehender, die Innenstadt fassender Rundweg bzw. attraktiver „linearer Park“ in der Stadt. Um die Barrierefreiheit und Nutzbarkeit zu erweitern ist die Sanierung und Erweiterung der bestehenden Wegefläche erfolgt. Zur Verbesserung der Orientierung und zur Optimierung der weiteren stadtinternen Vernetzung wurden die vielfältigen Orte und Einrichtung außerhalb der Kernstadt über thematische Routen verknüpft. Ergänzt wird das Projekt durch den Neubau eines an die Promenade angrenzenden Freizeitparcours sowie die Aufwertung des angrenzenden jüdischen Friedhofs. Alle aufgezählten Elemente konnten umgesetzt werden und die Promenade wurde im Juli 2023 mit einem großen Promenadenfest unter Beteiligung von Vereinen und Gewerbetreibenden eröffnet.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Fördergebiet Degerfeld, Stadt Butzbach, Hessen
Beschreibung
Unter dem Motto "Bewegung, Begegnung, Bildung" hat die Stadt Butzbach eine im Fördergebietes Degerfeld gelegene Wiesenbrache genutzt, um Aufenthalts- und Begegnungsflächen, allgemein zugängliche, gesunde Lebensräume und familiengerechte Freiräume in Wohnungsnähe der Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Ein sozial verträgliches Miteinander aller Altersgruppen wird durch entsprechende Begegnungs- und Bewegungsräume gefördert. Neben den im Umfeld bereits vorhandenen Räumen für Ballsport, wurde ein neuer naturnah und landschaftlich gestalteter, attraktiver Bewegungs- und Begegnungspark vorgesehen. Die Gesamtüberlegungen, wie auch die speziellen Inhalte wurden unter Beteiligung der Bevölkerung erarbeitet. Menschen aller Altersgruppen haben im Partizipationsverfahren mitgewirkt. Zunächst erfolgte die Ansprache der Bürgerschaft auf dem Marktplatz der Stadt Butzbach im Rahmen des Dialogforums „Butzbach bewegen“. In einem Pavillon wurden begleitend vertiefende Informationen kommuniziert und man konnte in direkten Dialog mit den Projektverantwortlichen treten. Ergänzend dazu wurden Fragebögen zum Ausfüllen angeboten. Danach wurde eine Planungs- und Ideenwerkstatt auf dem Planungsgelände durchgeführt. Hier gab es die Möglichkeit Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf Freiräume und die Themen Bewegung und Begegnung sowie Gestaltungsanregungen einzubringen. Es gab eine rege aktive Teilnahme unterschiedlicher Altersgruppen. Insgesamt wurden 76 Fragebögen ausgefüllt und die Veranstaltung wurde von ca. 90-100 Teilnehmern besucht. Ein großer Erfolg war die Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz und den zuständigen Archäologen. Möglichkeiten die besondere Geschichte des Ortes und seine Bedeutung als ehemaliger Standort eines Römerkastells und Vicus als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Limes in der Planung und Umsetzung einzubringen. Durch den Bau der Anlage konnte das archäologische Erbe im Boden gleichzeitig sichtbar und bespielbar werden, ohne die vorhandenen Bodendenkmäler zu zerstören.
Steckbrief der Einreichung (PDF)