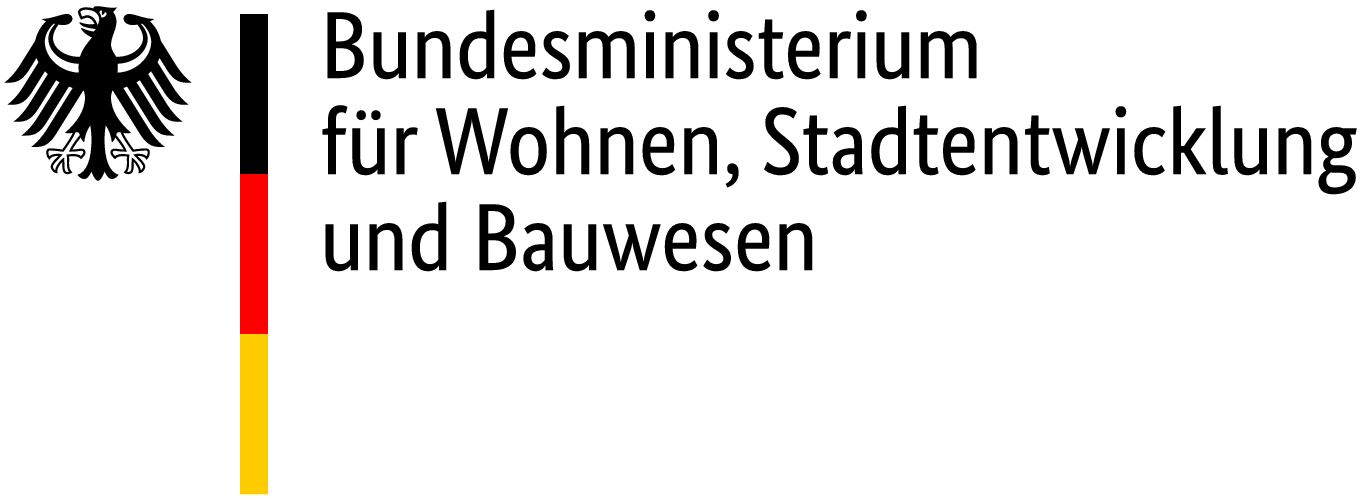Altstadt von Uslar, Stadt Uslar, Niedersachsen
Beschreibung
Mit attraktivem öffentlichen Grün für Freiräume, Outdoorsport und Bewegung im innerstädtischen Bereich zu sorgen, war die Zielsetzung. Ausgangslage: Im Jahr 1559 wurde Schloss Freudenthal im Stil der Weserrenaissance errichtet. Leider existiert es nur noch als Ruine in einem Park. Die Aufenthaltsqualität dort hatte stark abgenommen und der einst attraktive Parkraum war zu einem Durchgangsort mit Angsträumen geworden. Ziel dieses Projektes „Schloss Freudenthal neu belebt“ war es, den Menschen als Ausgleich zu den pandemiebedingten Einschränkungen der Lebensqualität innerstädtisch öffentlichen, hoch attraktiven Raum zur Naherholung, für soziale Begegnungen, für Sport, Spiel- und Freizeit zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig mit virtueller Technik neue Nutzungsformen des gesamten Stadt-Areals neu zu erschließen und damit jungen, technikaffinen Menschen eine Outdoor-Alternative zum PC bieten und das Areal „Schloss Freudenthal“ mit neuer, blau-grüner Infrastruktur touristisch als auch klimatisch und ökologisch aufzuwerten. Das Projekt „Schloss Freudenthal neu belebt“ umfasst die Bauarbeiten im Schlosspark, im Lavespark und eine für Uslar programmierte App mittels der man dramatische Ereignisse der der Stadt selber miterleben kann. Es gibt also einen thematischen, organisatorischen und räumlichen Zusammenhang der beiden Projekte. Beide Projekte wirken zusammen, verknüpfen digitale und stationäre Angebote und verleiten so alle Bevölkerungsgruppen zu verschiedenen Outdoor-Aktivitäten im urbanen Bereich.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Anerkennung in der Kategorie Bauliche Maßnahme
Ellwangen, Ellwangen, Baden-Württemberg
Fotos: Bundespreis Stadtgrün/Hergen Schimpf
Beschreibung
Einreichende Gemeinde: Ellwangen
Einwohnerzahl: 25.000
Bundesland: Baden-Württemberg
Der Brückenpark ist Teil des Geländes für die Landesgartenschau Ellwangen 2026 und noch nicht vollständig realisiert. Er stellt das Bindeglied zwischen der Ellwanger Altstadt und dem größeren Park entlang der Jagst dar und verbindet die Innenstadt u. a. durch einen Radweg mit dem zukünftigen Park.
Das Projekt stellt sich der komplizierten Aufgabe, eine aufgeständerte Bundesstraße und den Raum darunter in die Gestaltung eines Freiraums zu integrieren. Bislang befand sich unter diesem Brückenbauwerk der städtische Bauhof, dessen Umzug die Fläche zugänglich machte und die Verbindungsfunktion ermöglichte. Der Brückenpark nimmt die Potenziale des „Unorts“ in den Blick: Geräuschintensive Freizeitnutzungen wie eine Skateanlage und Kleinspielfelder bieten sich zur dortigen Platzierung an. Zugleich spendet die Brücke Schatten, der durch neu gepflanzte Pappelhaine ergänzt wird. So verwandelt das Projekt den ehemaligen Unort in einen lebendigen Freiraum für Sport und Spiel.
Jurybewertung
Der Brückenpark befasst sich auf vorbildliche Weise mit der Transformation eines in vielen Städten vorzufindenden Raumtyps, der häufig als Restraum hinter seinen Potenzialen zurückbleibt. Die Funktion des Raums unter der Brücke als Verbindung von der Innenstadt in den künftigen Stadtpark an der Jagst wird um vielfältige Bewegungsangebote angereichert. Dabei gelingt es, die Potenziale der Brücke als schattenspende Überdachung bei Hitze oder Schutz vor Regen zu erkennen und zu nutzen. Für den Brückenpark werden große Flächen entsiegelt, mit Baumhainen bepflanzt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dabei fängt der Park durch seine Ausstattung mit Bewegungsangeboten einen großen örtlichen Bedarf der Jugendlichen in Ellwangen auf.
Besonders würdigt die Jury, wie das beauftragte Planungsbüro den unansehnlichen Ort „unter der Brücke“ in einen Aktivitätsbereich mit außergewöhnlicher Atmosphäre verwandelt. Der Entwurf verbildlicht ein neues Narrativ, welches schon vor der Ausführung die Wahrnehmung des Ortes positiv beeinflusst: Ein Park für Bewegung und Sport mit einer Spielfläche in strahlendem Orange integriert das Brückenbauwerk als erlebbares, skulpturales Element im Kontrast zu den Naturräumen des großen grünen Parks auf der anderen Seite der Jagst.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Stadtkern Schifferstadt, Schifferstadt, Rheinland-Pfalz
Beschreibung
Die Umgestaltung des Kreuzplatzes ist das erste realisierte Projekt im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt". Seit 2018 ist Schifferstadt Teil dieses Programms, mit dem Ziel, eine Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität zu schaffen sowie die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Unter aktiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wurde der Kreuzplatz als barrierefreie und ansprechende Erholungszone konzipiert. Der Kreuzplatz ist nicht nur für Jung und Alt, sondern auch für die Umwelt gedacht. Er ist multifunktionaler Treffpunkt mit integrierten Grünflächen, Bewegungselementen und Raum für soziale Interaktion. Vor den Umbaumaßnahmen war der Kreuzplatz eine Freifläche mit einem Rasen, einem Bestand an Platanen und einem kleinen Blumenbeet. Die Fläche wurde zur Speyerer Straße hin durch parkende Autos begrenzt, und der Gehweg führte an beiden Längsseiten entlang bis zur Spitze der Dreiecksfläche. Insgesamt war der Platz ohne Aufenthaltsqualität. Am 28. Februar 2020 starteten die Baumaßnahmen. Ein wichtiger Aspekt dabei war die Pflanzgestaltung des Kreuzplatzes. Diese wurde sorgfältig geplant und berücksichtigt Vorschläge aus den Bürgerbeteiligungen. Eine Mischung aus insektenfreundlichen und optisch ansprechenden Kräutern, Stauden und Kletterpflanzen wie Thymian, Nachtkerze und Weinrebe schafft eine grüne Oase. Die Platanen blieben weiterhin fester Bestandteil des Platzes. Seit der Umgestaltung lädt die Fläche Besucher jeden Alters zu vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten ein. Egal, ob man den Bewegungspark erkundet, entspannte Spaziergänge unternimmt oder sich an den verschiedenen Geräten wie dem Drehstein und dem Gleichgewichtstrainer versucht. Ein Brunnen, ein Fahrradabstellplatz für 14 Räder sowie eine hölzerne Liegebank mit Blick auf den Brunnen tragen zur Funktionalität und Attraktivität des Platzes bei. Nach Abschluss der einjährigen Baumaßnahmen wurde das namensgebende Kreuz aus dem Jahr 1816 wieder aufgestellt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Spinnereigelände und Altort, Mainleus, Bayern
Beschreibung
Bei dem Projekt „Grüne Mitte“ Mainleus handelt es sich um die Umgestaltung einer überwiegend ruderal bewachsenen Teilfläche der Industriebrache „Alte Spinnerei“. Dies war der Auftakt eines umfangreichen städtebaulichen Erneuerungsprozesses, in dessen Ergebnis das Spinnereiareal grundhaft umgebaut, revitalisiert und sowohl gestalterisch als auch funktionell in die Ortslage integriert werden soll. Im nördlichen Teil der Industriebrache entwickelt die Marktgemeinde einen öffentlichen Park mit außergewöhnlicher ökologischer Qualität – die „Grüne Mitte“ Mainleus und deren Herzstück, einen zentralen neuen Teich. Maßgebliches Ziel des Projektes ist die Anpassung dieses innerörtlichen Grünbereiches an den Klimawandel. So soll im neuen Park eine innovative blau-grüne Infrastruktur entstehen, die das im gesamten Spinnereiareal anfallende Regenwasser vollständig speichern kann, um damit eine attraktive und nachhaltig mikroklimatisch wirksame Grünzone zu schaffen. Die Mainleuser Hauptstraße (Boulevard) ist Lebensader des Grundzentrums mit ca. 6.450 Einwohnern. Angesichts des Strukturwandels und der Verlagerung des Kfz-Verkehrs auf eine Umgehungsstraße im Jahr 1992 benötigt die Hauptstraße eine zukunftsfähige Entwicklungsperspektive. Obwohl entlang der Hauptstraße die wichtigsten Nutzungen des Ortes wie an einer Perlenschnur aufgereiht sind, handelt es sich bei der Straße um einen großflächig versiegelten und monofunktionalen öffentlichen Raum ohne Aufenthaltsqualität. Zur Anpassung des öffentlichen Raums an die geänderten Rahmenbedingungen werden unterschiedliche, ineinandergreifende Konzepte und Planwerke benötigt, die durch entsprechende Fachplaner erstellt werden. Durch eine abgestimmte Beteiligungsstrategie, die die Öffentlichkeit mit Vorträgen, Workshops und Arbeitsangeboten zum Mitmachen und Mitgestalten animiert und eine Veranschaulichung durch temporäre Maßnahmen soll frühzeitig eine Akzeptanz und Identitätsbildung für die Entwicklungen im Ortskern geschaffen werden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Kernstadt, Balingen, Baden-Württemberg
Beschreibung
Das Projekt ist im Rahmen der Gartenschau Balingen 2023 entstanden. Durch die Verlegung der Tennisplätze und den Rückbau der alten Anlage konnte die Fläche zu einem multifunktionalen Generationenpark mit einem breit gefächerten Angebot an Aktivitäten für alle Altersklassen umgestaltet werden. Zielsetzung war, einen Bereich für ALLE zu schaffen, in dem sich jeder wohl fühlt und ein geeignetes Bewegungsangebot für die eigenen Bedürfnisse findet. Um das zu erreichen, entstand der Aktivpark im Rahmen verschiedener Beteiligungsprojekte, bei denen Wünsche, Bedürfnisse und Anregungen aller Altersgruppen gesammelt, weitergesponnen und schließlich realisiert wurden. Hierbei ist auch der Synergieeffekt zu nennen, dass das Jugendhaus an den neuen Aktivpark verlegt wurde und somit der Nutzungsschwerpunkt für viele Aktivitäten räumlich direkt bei der Zielgruppe angesiedelt ist. Folgende Aktivitätsbereiche sind im Aktivpark integriert: ein Calisthenicspark, ein Schaukelbereich, ein Schachfeld, eine Beachvolleyballanlage, ein Streetballfeld, eine Skateanlage, eine Boulderwand, ein Trampolinfeld, eine Boulebahn, ein öffentlicher Bücherschrank, Seniorensportgeräte sowie eine multifunktional nutzbare, weitläufige Rasenfläche. Am 05. Mai 2023 ging mit Eröffnung der Gartenschau der Aktivpark gemeinsam mit den anderen Geländeteilen in die Nutzung über. Mit fast 500.000 Besuchern und über 20.000 verkauften Dauerkarten wurden alle Erwartungen übertroffen, das Interesse an den angebotenen Aktivitäten war immens. Von den über 1000 Veranstaltungen haben viele im Bereich des Aktivparks stattgefunden, z.B. der mehrmals wiederkehrende Skate-Jam, Streetball-Turniere, Boule-Veranstaltungen, Beachvolleyball-Events sowie verschiedene Sport- und Yogakurse. Aber auch an veranstaltungsfreien Tagen waren die Anlagen stets frequentiert und haben so bereits einen Ausblick darauf erahnen lassen, was die Nutzung im Nachgang der Gartenschau betrifft.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

08118 Hartenstein, Auwiesenweg, Sachsen
Beschreibung
Bereits in den 50er Jahren wurde das Areal durch den Bau der Fritz-Seidel-Schanze ein kultureller Magnet. Leider wurde Mitte der 70er Jahre der Sprungbetrieb wieder eingestellt. Anfang der 90er Jahre wurde eine kleine Pionierschanze wieder aufgebaut und von Hobbyspringer genutzt. In der Örtlichkeit sind die Reste noch deutlich zu erkennen. Das Eisstadion wurde im Zuge der Errichtung der Sprungschanze im Rahmen der NAW-Bewegung auch in den 50er Jahren gebaut. Auf der Basis einer vorliegenden Planung von 1990 wurde das Eisstadion saniert und später ein Volleyballplatz errichtet und somit das einstige sportliche Zentrum in Hartenstein weiterentwickelt. Gegenwärtig wird der Hang in Richtung Bahnhofstraße von Jung und Alt als Rodelhang für den Wintersport genutzt. Da das Areal nicht mehr attraktiv und ansprechend gestaltet war, sollte mit dem Vorhaben das sportliche Zentrum aufgewertet werden und eine Verbesserung der Wertschöpfung für den Freizeitbereich erfolgen. Den ortsnahen Schulen wurde durch die geplante Aufwertung eine Integration der Sportanlagen in den Schulunterricht ermöglicht. Da der „Auwiesenweg“ als Wanderweg und der überregionale Radweg „Karlsroute“ durch das Areal verlaufen, wird davon ausgegangen, dass etliche Touristen den Bereich passieren. Mit der Sanierung des Eisstadions, des Volleyballplatzes und der Errichtung von stationären Sportgeräten werden die Touristen zu sportlichen Aktivitäten motiviert. Desweitern wurde eine öffentliche Toilettenanlage in das neugestaltete Sportzentrum intergriert.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Bahnhof, Meerane, Sachsen
Beschreibung
Anlass war der Streckenausbau von Glauchau-Schönbörnchen nach Gößnitz sowie der Umbau des Bahnhofes Meerane und der Neubau eines Elektronischen Stellwerkes im Jahr 2011. Es war ein Vorhaben des Bundesschienenwegeausbaugesetzes. Das Bahnhofsgebäude, 2 große Güterschuppen, ein Lockschuppen und weitere Gebäude der Deutschen Bahn waren nicht Bestandteil der Maßnahme. Außerdem blieb eine riesige Fläche mitten in der Stadt ungenutzt, die jahrzehntelang als Güterbahnhof genutzt wurde. Die Stadt Meerane beantragte Finanzmittel für die Errichtung einer ÖPNV/SPNV Verknüpfungsstelle. Außerdem organisierten wir den Ankauf der großen Restflächen. Die Finanzmittel für die Verknüpfungsstelle wurden zugesagt, aber im Bewilligungszeitraum war das Vorhaben unmöglich umzusetzen. Im Zeitraum der Streckensperrung wurde eine Brücke über die Bahnschienen in der Baulast der Stadt Meerane abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Jahr 2013 wurde in unmittelbarer Nähe der Verknüpfungsstelle auf Wunsch vieler Jugendlicher eine Skateranlage errichtet. Diese wurde im Rahmen des Stadtumbauprogrammes gefördert. Nachdem endlich das gesamte ehemalige Bahngelände erworben war, wurde ein weiteres Projekt über den Stadtumbau angemeldet. In mehreren Bauabschnitten konnte nun das gesamte Gelände komplett umgestaltet werden (2017 – 2021). Ziel des Gesamtprojektes war die innerstädtische Belebung einer bis dato größtenteils ungenutzten und unnutzbaren Bahnanlage nebst Gebäuden. Darüber hinaus sollte ein Ort der Begegnung aller Altersgruppen geschaffen werden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Brumms Grund, Meerane, Sachsen
Beschreibung
Meerane ist nicht nur eine Stadt im Grünen, sondern eine grüne Stadt. Es gibt zahlreiche Wald- und Parkanlagen aus dem 19. Jhd., die bis in die Stadt hinein reichen und zu einen Grüngürtel ausgebaut werden sollen. Die Stadt unterstützt diesen Ausbau durch die Anlage von Streuobstwiesen, Rad- und Wanderwege in Verknüpfung mit bürgerschaftlichen Engagement und regionalen Nahrungskreisläufen. Der Grüngürtel spielt eine zentrale Rolle für die Klimaanpassung (Abkühlfunktion für Kessellage, Wasserretention bei Starkregenereignissen). Gegenstand des Projektes ist die Umgestaltung des Teilabschnitts Nord im Projektgebiet „Brumms Grund". Es handelt sich hierbei um eine städtische Fläche mit einer extensiven Grünlandnutzung. Umgesetzt wurde: Rad-/Wander- und Fußweg als wassergebundene Wegedecke mit einer Länge von ca. 500 m. Dieser schafft eine Verbindung zwischen dem Parkplatz Nelkenweg und der Hohen Straße und im weiteren Verlauf zum Wilhelm-Wunderlich-Weg und ergänzt damit das regionale Rad- und Wanderwegenetz positiv . Es erfolgte eine Bepflanzung des Wegrandes mit 40 Echten Kastanien. Weiterhin wurde eine Streuobstwiese auf einer Fläche von ca. 10.000 m2 mit 120 Obstbäumen angelegt. Um die Bestäubung der Obstbäume zu unterstützen, wurden im Areal Bienenvölker ansiedelt. Darüber hinaus wurde auf dem Gelände des städtischen Werkhofes der Bau einer Pilotanlage zur Regenwassernutzung mit der Ableitungen aus den Hallengebäuden realisiert. Das dabei aufgefangene Regenwasser wird zur Bewässerung der Obst- und Nussbäume verwendet. Die Pilotmaßnahme in „Brumms Grund" wurde nach dem Vorbild des LifeLocalAdapt Projektes Bad Düben durch einen intensiven Dialog mit Bürgern, Verwaltung, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Akteuren begleitet. Ein Konzept zur Klimaanpassung wurde modular entwickelt. Thematische Schwerpunkte sind für Meerane die Handlungsfelder: ,,Anpassung des Gehölzbestandes" an den Klimawandel, ,,Fassaden- und Dachbegrünung" u. ,,wassersensible Stadt''.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

Innenstadt, Obernkirchen, Niedersachsen
Beschreibung
Im Zuge der Stadtentwicklung, zur Verbesserung der Lebensqualität und Förderung der Gemeinschaft aller Einwohnergruppen über soziale, generationsübergreifende und kulturelle Unterschiede hinweg, wurden im innerstädtischen Bereich grüne Begegnungsorte geschaffen und aufgewertet. Diese ergänzen die direkt angrenzende allgemeine Wohnbebauung, den Kindergarten, die Seniorenwohnanlage, das Gemeindezentrum und das Jugendzentrum (B4). Das Projekt erstreckt sich über drei einzelne, im innerstädtischen Raum verteilter Standorte, die fußläufig erreichbar und miteinander verbunden sind. Dabei handelt es sich um den La-Flèche Park, den Jupp-Franke-Platz und den Bornemannplatz. Die Ausgestaltung dieser genannten Grünflächen wurde unter Berücksichtigung vorangegangener Bürgerbeteiligungen geplant und umgesetzt. In einem fortlaufenden Entwicklungsprozess werden zukünftig weitere Projektbausteine hinzugefügt. Schon jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten in Form von verschiedenen Outdoor-Fitnessgeräten, Boule-Bahn, Wassertretbecken und Aktivspielgeräten für Kinder. Die Bereiche sind jederzeit für alle zugänglich und können ganzjährig individuell genutzt werden. Die Angebote animieren zur körperlichen Aktivität, gleichzeitig laden die Orte mit Sitzbereichen zum Verweilen und Entspannen in den Grünoasen der Innenstadt ein. Die Stadt wird momentan schon unterstützt durch den Kneipp-Verein und ehrenamtliches Engagement der Bürger. Sichtbare Erfolge zeigen sich im Zusammentreffen aller angesprochenen Gruppen, gleichzeitig kommt von den Einwohnern ein positives Feedback.
Steckbrief der Einreichung (PDF)

65779 Kelkheim, Sindlinger Wiesen park Kelkheim, Hessen
Beschreibung
Kelkheimer Stadtpark „Sindlinger Wiesen“ – Teilumgestaltung
Der o. g. Stadtpark, der im Bereich der geplanten Umgestaltung dem Liederbach folgt, besitzt bereits natürlichen Charakter und verschiedene Biotope. Durch eine einfühlsame Aufwertung, im Hinblick auf den Menschen sowie Fauna und Flora, kann dieser Parkbereich nur dazugewinnen! Als Trittstein für Fauna und Flora stellt er ein wichtiges Bindeglied im urbanen Raum dar. Bei Fauna denken wir groß, denn allzu oft liegt der Fokus lediglich auf den Blütenbesuchern bzw. auf Insekten (Bienen!). Vögel, kleine Säugetiere, Reptilien und Amphibien, Spinnentiere, Krebstiere (z. B. Asseln), Gliederfüßer, Weichtiere (z. B. Schnecken), Würmer, sie alle gehören zum Netz des Lebens dazu! Die Bau- und Vegetationsmaßnahmen werden mit naturnahen Methoden geplant und ausgeführt. Die vielen verschiedenen Habitate, die durch das Angebot unterschiedlicher Materialien (Sande, Lebensraumholz, Stein, Pflanzen und alle ihre Teile) und Bauweisen (offene Bodenstellen, Fugen, Schattenbereiche etc.) sowie durch die Berücksichtigung der Bedürfnisse (Schutz, Wohnen, Fressen, Fortpflanzung) aller Lebewesen in ihrem kompletten Entwicklungskreislauf und ihrem Bewegungsradius, entstehen, werden die vorhandene, als auch künftige Fauna und Flora unterstützen. Ziel ist die Erhöhung der Artenvielfalt sowie der Individuenzahl, Steigerung der genetischen Vielfalt (= Steigerung der Resilienz) durch Austausch (Zu- /Abwanderung) mit weiteren grünen Trittsteinen im Umfeld, die durch diese Umgestaltung ebenfalls dazugewinnen und selbstverständlich auch die Erholung für den Menschen. Durch entsprechende Pflege z. B. Mosaikmahd, gemähte Wiesenwege (z. B. Grünspecht), belassene Wintersteher im Saum und zugelassene Dynamik, wird die Biodiversität gezielt unterstützt. Zusätzlich werden noch Informationstafeln und Bänke aufgestellt, die der Aufklärung bzw. bequemen Beobachtung dienen.
Steckbrief der Einreichung (PDF)